Last Updated on 08/01/2026 by CurleyInspire
Du bereitest dich auf das Longierabzeichen 5 (LA5) vor und suchst nach einem praxisnahen Leitfaden, der dich optimal auf die Prüfung vorbereitet? Egal, ob du gerade deinen ersten Longierkurs besuchst oder schon Erfahrung im Umgang mit Pferden hast – die Prüfung verlangt nicht nur theoretisches Wissen, sondern vor allem praktische Sicherheit, Einfühlungsvermögen und klare Hilfengebung.
In diesem Artikel findest du über 100 praxisnahe Fragen und Antworten, die alle relevanten Themen der Prüfung abdecken: vom fachgerechten Longieren, über Hilfszügel und die Ausbildungsskala bis hin zur Bodenarbeit, Stangenübungen und den ethischen Grundsätzen. Mit diesem Leitfaden kannst du dich gezielt auf die Prüfung vorbereiten, dein Wissen testen und reflektieren, was in der Praxis wirklich zählt.
🔹 A. Ziel & Zweck des Longierens
1. Warum longieren wir Pferde?
Um das Pferd ohne Reitergewicht zu gymnastizieren, Muskulatur und Kondition zu fördern, Losgelassenheit zu erreichen und das Pferd an die Hilfen und Stimme zu gewöhnen.
2. Welche Ziele kann das Longieren haben?
Verbesserung von Takt, Balance, Durchlässigkeit, Kondition und Vertrauen – je nach Ausbildungsstand auch Vorbereitung auf das Reiten.
3. Wann ist Longieren sinnvoll, wann eher nicht?
Sinnvoll zur Gymnastizierung oder Abwechslung; nicht sinnvoll bei unausbalancierten jungen Pferden ohne Grundausbildung oder bei Pferden mit Gelenkproblemen auf engem Zirkel.
4. Was versteht man unter gymnastizierendem Longieren?
Bewusstes Arbeiten über den Rücken, mit Dehnung, Übergängen und Handwechseln, um Muskulatur, Beweglichkeit und Gleichgewicht zu fördern.
5. Welche Vorteile hat Longieren für Reiter und Pferd?
Das Pferd wird geschmeidiger, der Reiter kann Einwirkung und Körpersprache üben oder seinen Sitz schulen.
6. Wann würdest du auf das Longieren verzichten?
Bei Krankheit, Lahmheit, Muskelverspannung oder Stress – oder wenn das Pferd an dem Tag geistig überfordert ist.
7. Was ist der Unterschied zwischen „Bewegung an der Longe“ und „Ausbildung an der Longe“?
„Bewegung“ ist reine Bewegung ohne gezieltes Ziel; „Ausbildung“ ist systematisch mit gymnastizierender, fördernder Absicht.
8. Warum ist das Aufwärmen so wichtig?
Um Muskulatur, Gelenke und Kreislauf vorzubereiten und Verletzungen zu vermeiden.
9. Warum wird beim Longieren eine Longe verwendet?
→ Sie ermöglicht die Verbindung zwischen Mensch und Pferd auf Distanz und überträgt feine Hilfen.
10. Wofür dient die Peitsche beim Longieren?
→ Als verlängerter Arm zur Unterstützung der treibenden Hilfen, nie als Strafinstrument.
🔹 B. Sicherheit & Verhalten am Pferd
1. Wie hält man die Longe korrekt?
In weiten Schlaufen, nicht aufgewickelt, Daumen oben, gleichmäßiger Kontakt – Sicherheit zuerst!
2. Warum darf man die Longe nie um die Hand wickeln?
Verletzungsgefahr – bei plötzlichem Ziehen kann die Hand schwer verletzt werden.
3. Wie führst du die Peitsche sicher?
Locker in der anderen Hand, leicht nach unten zeigend, bereit zum Einsatz – aber ruhig und kontrolliert.
4. Wo steht der Longenführer ideal?
Etwa auf Schulterhöhe, leicht hinter dem Pferd, mit klarer Körperausrichtung und sicherem Abstand.
5. Wie reagierst du, wenn das Pferd scheut oder losrennt?
Ruhe bewahren, tief sprechen, Körpersprache klein machen, Longe kontrolliert nachgeben, Situation sichern.
6. Warum darf der Zirkel nicht zu klein sein?
Zu enge Kreise überlasten Gelenke, Bänder und Sehnen – ideal sind 18–20 m Durchmesser.
7. Was machst du, wenn das Pferd nach innen drängt oder ausbricht?
Position anpassen, Energie mit Körpersprache steuern, bei Bedarf Stimme oder Peitsche einsetzen.
8. Warum ist dein eigener Körperausdruck wichtig?
Weil Pferde Körpersprache lesen – klare Haltung schafft Vertrauen und Verständnis.
9. Wie steuerst du Tempo und Richtung?
Mit Stimme, Energie, Position und Blick – nicht mit Zug an der Longe.
10. Warum ist deine eigene Losgelassenheit entscheidend?
Deine Spannung überträgt sich direkt aufs Pferd – Gelassenheit fördert Vertrauen und Harmonie.
🔹 C. Ausrüstung & Hilfszügel
1. Welche Ausrüstung gehört zum Longieren mit Trense?
Trense mit Gebiss, Longe, Longiergurt, Ausbinder oder Dreieckszügel, Peitsche, Handschuhe und Helm.
2. Warum sollte ein Kappzaum korrekt angepasst sein?
Damit er ruhig liegt, nicht scheuert und die Impulse präzise übertragen werden.
3. Wann setzt du Hilfszügel ein – und wann lieber nicht?
Wenn das Pferd sie kennt und sie seiner Ausbildung dienen; nicht bei jungen, unerfahrenen oder ängstlichen Pferden.
4 Welche Wirkung haben Dreieckszügel?
Sie fördern eine konstante Anlehnung und laden das Pferd zur Dehnungshaltung ein, ohne es festzuhalten.
5. Wie unterscheidet sich die Wirkung von Ausbindern und Laufferzügeln?
Ausbinder fixieren den Rahmen stärker; Laufferzügel erlauben dem Pferd mehr Beweglichkeit und eine feinere Anpassung.
6. Welche Vor- und Nachteile haben Ausbinder?
Dreieckszügel fördern Dehnung, Ausbinder geben Halt, können aber fest wirken; Laufferzügel sind variabler, aber komplexer zu verschnallen.
| Hilfszügelarten | Vorteile | Nachteile |
| Ausbilderzügel | – Gute seitliche Führung – Pferd kann sich vom Gebiss abstoßen | – Kein Vorwärts Abwärts möglich ohne mit der Nasenlinie hinter die Senkrechte zu kommen |
| Dreieckszügel | – Tiefe Dehnungshaltung möglich, ohne hinter die Senkrechte zu kommen – Das Pferd kann sich vom Gebiss abstoßen | – keine seitliche Führung – Wenig losgelassene Pferde arbeiten gegen einen zu tief oder engen Dreieckszügel und halten sich fest. -Pferd kann auf die Vorhand fallen |
| Laufferzügel | – AM tiefen Laufferzügel Vorwärts-Abwärts gehen möglich – Gute seitliche Führung – Pferd kann sich vom Gebiss abstoßen | Ermöglichen nicht die tiefe, korrekte Dehnungshaltung, wie der Dreieckszügel |
7. Wie stellst du Dreieckszügel korrekt ein?
So, dass das Pferd in Dehnungshaltung die Nase etwa vor der Senkrechten trägt, ohne eingeschränkt zu werden.
8. Warum dürfen Hilfszügel nie zu eng verschnallt sein?
Weil sie das Pferd in der Bewegung blockieren, die Muskulatur verspannen und die Atmung behindern können.
9. Welche Ausrüstung brauchst du?
Kappzaum oder Trense, Longe, Peitsche, Handschuhe, evtl. Hilfszügel, passender Boden, geschlossene Halle oder umzäunter Platz.
10. Wie hältst du die Longe richtig?
In geordneten Schlaufen in der Hand, nie um die Hand gewickelt!
11. Wie gehst du sicher mit der Peitsche um?
Sie wird ruhig getragen, zeigt zum Pferd, dient der Hilfengebung – nicht der Strafe.
12. Wie befestigst du den Dreieckszügel korrekt?
Am Gurt seitlich durch die Gebissringe – er soll eine sanfte Begrenzung geben, keine Zwangshaltung.
13. Wann verzichtest du auf Hilfszügel?
Wenn das Pferd noch unausbalanciert ist oder du seine natürliche Bewegung nicht einschränken willst.
14. Welche Hilfszügel dürfen beim LA 5 verwendet werden?
Dreieckszügel oder Laufferzügel.
15. Welche Vor- und Nachteile haben Dreieckszügel?
Sie fördern die Dehnungshaltung und geben seitliche Begrenzung.
16. Wie wirken Laufferzügel? Welche Vor- und Nachteile haben sie?
Sie ermöglichen dem Pferd mehr Bewegungsfreiheit bei korrekter Haltung.
17. Wann sollte man ohne Hilfszügel longieren?
Bei jungen, unausbalancierten Pferden oder zu Beginn der Einheit.
18. Was ist das Ziel der Hilfszügel?
Unterstützung, keine Zwangshaltung – sie sollen das Pferd in die richtige Dehnung führen.
19. Welchen Beinschutz gibt es und wann sollte man besser keine Bandagen verwenden?
Gamaschen, Streichkappen, Hufglocken, Bandagen. Bei Nässe/Matsch sollte man keine Bandagen verwenden, weil sie sich durch die Feuchtigkeit zuziehen und das Gewebe der Beine schädigen können.
20. Wie lang sollte eine Longierleine sein und was muss sie unbedingt haben?
Laut Unterlagen für das Longierabzeichen 7-8m. In den neuen Richtlinien 8,50 – 9,50 m mit einer Handschlaufe (20cm)
21. Wie lang ist eine Longierpeitsche und wovon hängt die Länge ab?
Die Longierpeitsche sollte mit Schnur mind. 7,5m lang sein bzw. so lang sein, dass man mit getrecktem Arm das Pferd erreicht und orientiert sich an der Größe des Longierzirkels. Bsp. Teleskoppeitsche beim Volitgieren (Stablänge 3m, Schlag 5m)
22. Warum sollten bei einer Longierleine keine Querstege aufgenäht sein?
Weil sie die notwendige Gleitfähigkeit der Longe behindern und Verletzungen beim Longenführer verursachen können.
Meine persönliche Equipment-Empfehlung
Pferde sind generell ein teures Hobby. Dennoch sollte man sich bei der Anschaffung des Equipments Gedanken machen. Der hier empfohlene Longiergurt und die dazu passende Longiergurtunterlage haben sich bei mir bewährt. Eine günstige aber gute Softlonge findet ihr etwas weiter unten oder hier: Softlonge 8m (12,95€ Amazon*). Ich bin Fan von Farben. So findet man seine Longierleine, sollte sie einmal abhanden kommen, schnell wieder. 😉


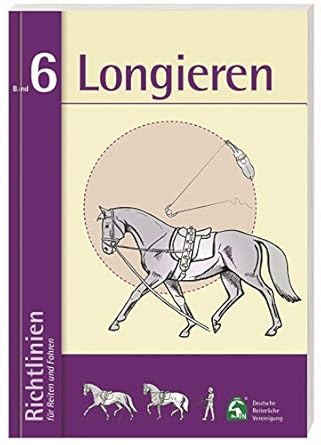





🔹 D. Skala der Ausbildung beim Longieren
1. Was bedeutet „Takt“ an der Longe?
Gleichmäßiger, klarer Bewegungsrhythmus in allen Gangarten.
2. Wie erkennst du „Losgelassenheit“ beim Longieren?
Schwingender Rücken, pendelnder Schweif, rhythmisches Atmen, weiches Maul, gleichmäßiger Takt, kauen und abschnauben. Das Pferd such vertrauensvoll die Anlehnung.
3. Was ist mit „Anlehnung“ an der Longe gemeint?
Ein elastisches Mitgehen in der Verbindung zwischen Pferdemaul und Longenführer, kein Ziehen oder Nachgeben.
4 Wie kann man Schwung fördern, ohne das Pferd zu treiben?
Durch Übergänge, Zirkellinien verändern, Stimme und Körperspannung – das Pferd motivieren statt antreiben.
5. Was bedeutet „Geraderichten“ beim Longieren auf einer Kreislinie?
Das Pferd soll auf dem Kreis gleichmäßig gebogen sein, nicht über Schulter oder Hüfte ausweichen.
6. Wie erkennst du, dass dein Pferd im Gleichgewicht läuft?
Es trägt sich selbst, läuft mit gleichmäßigem Tempo und weichem Bewegungsfluss ohne Hektik oder Wanken.
7. Was verstehst du unter einer „positiven Spannung“?
Das Pferd ist aufmerksam und aktiv, aber losgelassen – Körper und Geist arbeiten zusammen.
8. Was kannst du tun, wenn dein Pferd auf einer Hand steifer ist?
Häufige Handwechsel, Übergänge, Zirkelvergrößerungen, Seitengänge an der Longe und ruhiges, gymnastizierendes Arbeiten.
9. Welche Ausbildungsskala gilt auch beim Longieren?
Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, Geraderichtung, Versammlung.
10. Was ist Losgelassenheit?
Ein körperlicher und mentaler Zustand, in dem das Pferd locker, im Gleichgewicht und durchlässig ist.
11. Was bedeutet Geraderichten?
Das Pferd läuft auf beiden Händen gleichmäßig geradegerichtet, ohne nach innen oder außen zu fallen.
12 Welche Skala der Ausbildung gilt auch beim Longieren?
Takt – Losgelassenheit – Anlehnung – Schwung – Geraderichtung – Versammlung.
13. Was bedeutet Takt beim Longieren?
Gleichmäßiger Rhythmus in allen Gangarten.
14. Woran erkennst du Losgelassenheit?
Pendeln des Schweifs, gleichmäßige Atmung, weicher Rücken, offenes Maul.
15. Wie zeigt sich Anlehnung an der Longe?
Pferd sucht die Hand, trägt sich selbst, bleibt in konstanter Verbindung.
16. Wie kannst du Schwung fördern?
Durch Übergänge, Tempounterschiede und motivierende Stimme.
17. Was ist eine Verwerfung?
Eine Verwerfung ist eine seitliche Abweichung von Kopf und Hals, bei der diese nicht in einer Linie mit dem Rumpf stehen, ohne dass sich die Wirbelsäule des Pferdes biegt.
18. Wo hört die Verwerfung auf? (Kein Witz, wurde schon mal so gefragt)
Die Verwerfung hört dort auf, wo die Wirbelsäule beginnt, also an der Halsbasis im Übergang von Hals zu Rumpf.
19. Woran erkennt man eine Verwerfung beim Longieren?
- Kopf und Hals sind seitlich gestellt
- Das Pferd schaut nach innen oder außen
- Der Rumpf bleibt gerade
- Die Wirbelsäule ist nicht gebogen
20. Warum ist Verwerfung unerwünscht?
Weil sie eine korrekte Anlehnung verhindert, die Losgelassenheit beeinträchtigt und das Geraderichten erschwert. Zudem wird die natürliche Schiefe des Pferdes verstärkt.
21. Was ist der Unterschied zwischen Verwerfung und Biegung?
Bei der Verwerfung sind nur Kopf und Hals seitlich abweichend, ohne Beteiligung der Wirbelsäule.
Bei der Biegung ist die Wirbelsäule von Kopf bis Schweif gleichmäßig gebogen.
22. In welchem Zusammenhang steht Verwerfung mit der Skala der Ausbildung?
Verwerfung wirkt sich negativ auf die Punkte Losgelassenheit, Anlehnung und Geraderichten aus und verhindert damit eine korrekte gymnastizierende Ausbildung des Pferdes im Sinne der Skala der Ausbildung – auch beim Longieren.
23. Wie kann man Verwerfung beim Longieren korrigieren?
- klare, ruhige Hilfen
- korrekte Position des Longenführers
- gleichmäßiger, elastischer Kontakt zur Longe
- gezielte Aktivierung der Hinterhand, z. B. mit der Peitsche
- Arbeit an Takt und Losgelassenheit als Grundlage
🔹 E. Praktische Durchführung
1. Wie beginnst du eine Longierarbeit?
Mit ruhigem Führen, Aufwärmen im Schritt, allmählichem Herantasten an den Trab und Galopp.
2. Welche Aufwärmphase ist sinnvoll?
Mindestens 10 Minuten Schritt und ruhiger Trab ohne Hilfszügel, um Muskulatur und Kreislauf vorzubereiten.
3. Wie gestaltest du den Handwechsel korrekt und sicher?
Pferd zum Schritt durchparieren, auf dich zukommen lassen, Longe umgreifen, ruhig auf die andere Hand schicken.
4. Wie sehen Übergänge beim Longieren aus?
Klar erkennbar, über Stimme und Körpersprache eingeleitet, fließend ohne Spannung.
5. Woran erkennst du, dass dein Pferd zufrieden ist?
Entspannte Mimik, Kauen, Abschnauben, ruhige Runden, gespannte Aufmerksamkeit ohne Stress.
6. Wie kannst du mit Stimme und Körpersprache einwirken?
Körper aufgerichtet = mehr Energie; klein machen = beruhigen; Stimme hell = aktivierend; tief = beruhigend.
7. Warum ist ein ruhiger, gleichmäßiger Ablauf wichtig?
Weil Pferde auf Wiederholung und Konstanz reagieren; hektische Abläufe verunsichern sie.
8. Was machst du nach dem Longieren?
Locker ausschreiten lassen, Hilfszügel lösen, Longe korrekt aufwickeln, Pferd loben und ggf. absatteln oder führen.
9. Wie kannst du Longieren zur Sitzschulung des Reiters nutzen?
Das Pferd wird vom Longenführer gearbeitet, der Reiter kann sich ganz auf seinen Sitz und die Balance konzentrieren.
10. Was ist der Unterschied zwischen Longieren und Doppellonge?
Bei der Doppellonge wird von beiden Seiten eingewirkt – ähnlich wie beim Reiten, mit direkter Zügelverbindung.
11. Wie erkennst du, ob dein Pferd auf dem Zirkel korrekt läuft?
Wenn es im Gleichgewicht ist, Takt hält und nicht nach innen fällt.
12. Wie steuerst du Tempo und Richtung?
Mit Körpersprache, Stimme und klarer Position auf dem Zirkel.
13. Was machst du, wenn dein Pferd stark nach innen zieht?
Position korrigieren, innere Körperspannung aufbauen, Energie nach außen lenken.
14. Wie machst du einen Handwechsel?
Über das Durchparieren zum Schritt, Wechseln der Position, Sortieren von Longe und Peitsche, neues Anlongieren.
15. Was ist der häufigste Fehler beim Longieren?
Zuviel Druck, zu wenig Struktur – das Pferd läuft hektisch statt losgelassen.
16. Wo steht der Longenführer richtig?
Etwa auf Höhe der Pferdeschulter.
17. Was bedeutet deine Körperhaltung für das Pferd?
Sie steuert Energie und Richtung – offene Körperhaltung = treiben, zurücklehnen = parieren.
18. Wie arbeitest du mit der Stimme?
Klar, ruhig, gleichbleibende Kommandos (z. B. „Trab“ oder „Hoo“).
19. Wie gibst du ein Handwechsel-Signal?
Durchparieren, Körpersprache drehen, neue Stellung einnehmen, neu anlongieren.
20. Warum ist deine eigene Losgelassenheit wichtig?
Weil Spannung und Hektik sich direkt aufs Pferd übertragen.
🔹 F. Fragen zu Tierschutzgesetz & Ethik
1. Was bedeutet §1 des deutschen Tierschutzgesetzes?
Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.
2. Welche Verantwortung hat der Mensch laut Tierschutzgesetz gegenüber dem Pferd?
Für Wohlbefinden, Gesundheit und artgerechte Haltung zu sorgen und Leiden zu vermeiden.
3. Was versteht man unter „vernünftigem Grund“?
Ein Grund, der dem Tierwohl nicht widerspricht – z. B. medizinische Behandlung, Ausbildung in angemessenen Grenzen.
4 Was schreibt das Tierschutzgesetz vor?
Kein Tier darf ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden erfahren (§1 TierSchG).
5. Wie setzt du das beim Longieren um?
Kein Zwang, keine Überforderung, Training nach körperlicher und mentaler Verfassung des Pferdes.
6 Was sagen die FN-Ethischen Grundsätze?
Das Wohl des Pferdes steht über sportlichen oder wirtschaftlichen Interessen.
7. Was tust du, wenn dein Pferd Unwillen zeigt?
Ursache suchen – Schmerz, Überforderung, Missverständnis – nicht bestrafen.
8. Wie lange sollte eine Longiereinheit dauern?
Ca. 20–30 Minuten inklusive Aufwärmen und lockerem Abschluss.
9. Was sind Anzeichen für Stress oder Überforderung beim Pferd?
Angespannte Mimik, Schweifschlagen, Zähneknirschen, unregelmäßiger Takt, Unruhe oder Verweigerung.
10. Was bedeutet „Zwangsmaßnahmen vermeiden“ beim Longieren?
Keine Gewalt, kein Festhalten – das Pferd soll verstehen und freiwillig mitarbeiten.
11. Warum ist artgerechter Umgang wichtiger als sportlicher Ehrgeiz?
Nur ein zufriedenes, gesundes Pferd kann dauerhaft leisten – Ethik steht über Erfolg.
12. Was regeln die Ethischen Grundsätze der FN?
Sie verpflichten zu Achtung, Verantwortung und partnerschaftlichem Umgang mit dem Pferd.
13. Wie kannst du als Longenführer zur Gesunderhaltung beitragen?
Durch abwechslungsreiches Training, richtiges Aufwärmen, passende Ausrüstung und Rücksicht auf Tagesform.
14. Wie erkennst du, dass dein Pferd überfordert ist?
Verlust von Takt, Spannung, Unwilligkeit, Vermeidung oder körperliche Ermüdung.
15. Wie reagierst du, wenn jemand ein Pferd grob behandelt?
Ruhe bewahren, sachlich ansprechen, aufklären oder – falls nötig – den Ausbilder oder Verantwortlichen informieren.
16. Woran erkennst du, dass dein Pferd überfordert ist?
Hoher Kopf, gespannte Muskulatur, unruhiger Takt, Schweifschlagen.
17. Was tust du bei Unruhe oder Spannung?
Tempo rausnehmen, Stimme beruhigen, evtl. Hand wechseln.
18. Wie reagierst du bei Eiligwerden?
Energie nach außen lenken, Stimme beruhigend einsetzen, kleineren Zirkel vermeiden.
19. Was zeigt dir ein Pferd mit „hängendem Rücken“?
Fehlende Aktivität, Spannung oder Verspannung – Ursache prüfen.
20. Wie erkennst du, dass dein Pferd zufrieden arbeitet?
Ruhiger Gesichtsausdruck, Kauen, entspannte Bewegung.
🔹 G. Bodenarbeit
1. Wie führst du dein Pferd auf der Dreiecksbahn korrekt vor?
Du führst das Pferd mit ruhiger Hand und klarer Körpersprache, achtest auf gleichmäßigen Schritt und Trab, saubere Linienführung und Aufmerksamkeit des Pferdes.
2. Wie planst du Stangenübungen für die Bodenarbeit?
Du legst Stangen in unterschiedlichen Formen (Kreuz, Labyrinth, gerade Linie) aus und passt die Übung dem Ausbildungsstand des Pferdes an, um Koordination, Gleichgewicht und Aufmerksamkeit zu fördern.
3. Wie reagierst du, wenn dein Pferd die Stangen meidet oder darüber stolpert?
Ruhe bewahren, das Pferd motivierend führen, ggf. Tempo anpassen oder die Übung vereinfachen; auf positive Verstärkung achten.
4. Wie bereitest du dein Pferd auf Umweltreize vor?
Schrittweise Annäherung an unbekannte Gegenstände oder Geräusche, ruhiges und geduldiges Vorgehen, Pferd beobachten und nur soweit fordern, wie es entspannt bleibt.
5. Welche Distanz solltest du zu deinem Pferd auf der Dreiecksbahn halten?
Sicherer Abstand, sodass das Pferd dich spürt, aber nicht berührt; genug Platz, um auf Ausweichbewegungen reagieren zu können.
6. Wie integrierst du Handwechsel in der Bodenarbeit?
Pferd in Schritt durchparieren, Longe neu anlegen, Hand wechseln, Pferd erneut kontrolliert anlongieren.
7. Welche Signale nutzt du zur Steuerung von Tempo und Richtung?
Körpersprache, Stimme, Peitsche als Signal, aber nie als Strafe; Position auf der Bahn beeinflusst Bewegungsrichtung.
8. Wie erkennst du, ob dein Pferd die Aufgaben versteht?
Ruhige Mimik, Aufmerksamkeit, gleichmäßiger Takt, freiwillige Mitarbeit ohne Stressanzeichen.
9. Wie gehst du vor, wenn dein Pferd unsicher auf einen Reiz reagiert?
Langsam zurücknehmen, beruhigend sprechen, Abstand wahren, positive Verstärkung einsetzen und keine Überforderung zulassen.
10. Wie reflektierst du deine Bodenarbeits-Einheit nach der Prüfung?
Beobachten, wie Pferd auf Aufgaben reagiert hat, welche Hilfen effektiv waren, was verbessert werden könnte; Notizen für weitere Trainingsplanung machen.
11. Wie reagierst du, wenn dein Pferd auf der Dreiecksbahn immer wieder die Linie verlässt?
Durch ruhige Korrektur, Körpersprache und ggf. Stimme oder Peitsche das Pferd wieder in die richtige Bahn führen, ohne Druck auszuüben.
12. Wie kannst du die Aufmerksamkeit deines Pferdes während der Stangenarbeit erhöhen?
Durch klare Signale, langsames Herantasten an Aufgaben, Variation der Übungen und konsequente, ruhige Führung.
13. Wann ist es sinnvoll, Bodenarbeit mit Stangen in Trab oder Galopp durchzuführen?
Wenn das Pferd die Grundübungen im Schritt sicher beherrscht und körperlich stabil ist, um Koordination und Gleichgewicht zu verbessern.
14. Wie baust du eine sichere Stangen-Übung für junge Pferde auf?
Mit wenigen Stangen in gerader Linie, niedriger Geschwindigkeit, Schritt oder ruhiger Trab, klare Führung und lobende Verstärkung.
15. Wie gehst du mit einem Pferd um, das auf neue Geräusche oder Bewegungen unsicher reagiert?
Langsam herantasten, Ruhe bewahren, Pferd beobachten, positive Verstärkung einsetzen und keine Überforderung zulassen.
16. Wie integrierst du Übergänge zwischen Schritt, Trab und Galopp in die Bodenarbeit?
Klar ankündigen durch Körpersprache und Stimme, fließend durchführen, Pferd kontrolliert auf der Bahn halten, auf Takt und Losgelassenheit achten.
17. Wie beurteilst du die Sicherheit deines Pferdes bei der Arbeit über Stangen oder in einem Labyrinth?
Pferd bleibt gelassen, geht ohne Stolpern über Stangen, zeigt gleichmäßigen Takt und koordiniertes Bewegungsmuster.
18. Wie reagierst du, wenn dein Pferd auf Stangen unruhig wird oder ausweicht?
Ruhig zurücknehmen, Übung vereinfachen, Pferd motivierend führen, klare Körpersprache einsetzen.
19. Wie planst du eine abwechslungsreiche Bodenarbeit für eine Prüfungseinheit?
Kombination aus Dreiecksbahn, Stangenarbeit, Übergängen, Handwechseln und leichten Umweltreizen, angepasst an Kondition und Ausbildungsstand des Pferdes.
20. Wie überprüfst du die Wirkung deiner Hilfen in der Bodenarbeit?
Beobachtung von Takt, Losgelassenheit und Reaktion des Pferdes auf Stimme, Peitsche, Körpersprache und Longe; Anpassung der Hilfengebung bei Bedarf.
21. Wozu dienen Stangenübungen in der Bodenarbeit?
Sie fördern Koordination, Gleichgewicht, Aufmerksamkeit und Beweglichkeit des Pferdes, helfen beim Aufbau der Muskulatur und machen das Pferd feinfühlig für Hilfen.
22. Warum ist Körpersprache bei der Bodenarbeit so entscheidend?
Weil das Pferd Körpersprache als Hauptsignal wahrnimmt. Die Position, Haltung und Energie des Menschen steuern Tempo, Richtung, Motivation und Sicherheit des Pferdes. Ruhige, klare Körpersignale verhindern Stress, unterstützen Losgelassenheit und erhöhen die Wirkung von Stimme und Peitsche.
Wenn euch diese Liste beim Abzeichen geholfen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare eure Fragen mit aufschreiben könntet. So können alle davon lernen. 🙂


2 Comments
Was ich aus dem Longierabzeichen gelernt habe – und warum ich heute ganz anders longiere - der-pferdeblog.de
20. Dezember 2025 at 18:46[…] Fragensammlung Longierabzeichen LA4 + LA5 – Praxisnah erklärt […]
Prüfungsvorbereitung: RA 5, RA 4 & Longierabzeichen LA 5 und LA 4 – Dein Guide - der-pferdeblog.de
4. Januar 2026 at 09:17[…] Fragensammlung Longierabzeichen LA4 + LA5 – Praxisnah erklärt […]